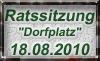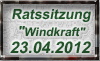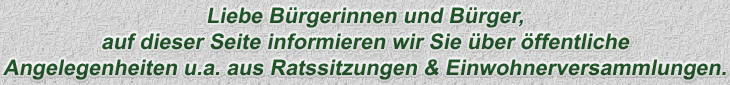|
Der Gemeinderat berät
einen Haushalt, ohne daß die Jahresbilanz für 2011/2012
vorliegt. Weiter fehlen die Haushaltsprüfungen für
2011/2012.
Es ist also kaum möglich, den tatsächlichen
Istzustand der Gemeinde und damit den Finanzbedarf für die
Gemeinde festzustellen. Ohne Vorlage der geprüften
Vorjahresbilanzen ist zwar eine Beratung eines Haushaltes möglich
-ein Haushaltsbeschluß widerspricht unter diesen Umständen den
Vorgaben ordentlicher Geschäftsführung.
Wie in der Einleitung
ausgeführt, hängt das Wohl und Wehe unserer Gemeinde an der
finanziellen Ausstattung. Die finanzielle Ausstattung teilt sich
grundsätzlich in zwei Bereiche.
Teil 1:
"staatliche Zuweisungen und gemeindliche Steuern"
Dieser Teil muß in der Summe die "Werterhaltung" der
Gemeinde sicherstellen. Die Gelder müssen also ausreichen, den
Verbrauch der Infrastruktur auszugleichen (Rücklagenbildung), die
Verwaltung zu finanzieren, sowie die Finanzierung notwendiger
Ausgaben, z.B. den Bau und den Unterhalt ggf. gesetzlich
geforderter Einrichtungen (Kindergärten etc.)
sicherzustellen.
Zusätzlich sind entsprechend der Forderung der VBB e. V.
-Vereinigung Bürger für Bürger (s.a. Stellungnahme des GStB)
und der Rechtsprechung des Landesverfassungsgerichtshofes weitere,
freie finanzielle Mittel zur Entwicklung der Gemeinde
bereitszustellen.
Denken Sie bitte immer
daran;
Verschenkt wird hier nichts -es ist Ihr Geld, was den Gemeinden
verweigert wird- um damit z.B. Posten und Pöstchen zu
finanzieren, oder Großflughäfen unter die Erde zu bekommen.
Teil 2:
"gemeindliche Einnahmen" (s.a. Ausführung, unten)
Hierunter sind Einnahmen aus speziellen Leistungen der Gemeinde zu
verstehen. Unter diesen Leistungen verstehe ich Einnahmen, z.B.
aus dem Forst, dem Steinbruch, der Windkraft (falls diese doch
noch kommt), der Photovoltaik etc.
Damit werden Gemeinden befähigt, besondere Ansprüche der BürgerInnen
zu erfüllen. Z.B. würde ich die Senkung oder Abschaffung der
Gewerbesteuer und der Grundsteuern empfehlen, die
Brennholzversorgung der BürgerInnen zum gemeindlichen
Selbstkostenpreis, eine Eigenenergieversorgung in die Wege leiten
und soziale Projekte anstoßen; über die private Kinderbetreuung,
einen Dorfladen oder einer Versorgung mit Gemeindeschwestern
-kurzum, die Gemeinde möglichst attraktiv gestalten.
Im Prinzip fordert
selbst der GStB eine derartige Finanzausstattung.
Die Realität schaut dagegen wie folgt beschrieben aus:
Die finanzielle
Mindestausstattung (s.u. Teil1) erhalten wir vom Land ggf. vom
Bund. Doch noch bevor wir diese Gelder für unsere Gemeinde
verwenden können, haben Verbandsgemeinde und Landkreis diese
Gelder unserer Gemeinde entzogen. Das System des Entzuges der
Mittel funktioniert wie bei Ihrer Gehaltsabrechnung. Sozialabgaben
und Steuern schmälern viele Einkommen bis unterhalb des
Existenzminimums
| Umlagen
-kalte Enteignung- |
Derzeit beträgt
der Abgabensatz = Umlagesatz
für die VG-Manderscheid 37%
und für den
Landkreis Bernkastel-Wittlich 45,73%,
die Landesumlage des Fonds dt.Einheit wird ebenfalls
bedient.
Summa
summarum wird unsere Gemeinde um mehr als 84% der Haupteinnahmen
gebracht.
(Haupteinnahmen = Einnahme aus Steuern und Zuweisungen (s.
Teil1))
Für
2013 erhalten wir "Haupteinnahmen" von über
145.000,00 EUR.
Bis auf ca. 12.000 EUR werden wir geschröpft. Die
Abgabenquote liegt bei über 90%!
|
Für
2014 erwarten wir "Haupteinnahmen" von über
177.000,00 EUR.
Bis auf ca. 25.000 EUR werden wir geschröpft. Die
Abgabenquote liegt bei über 85%!
|
Kosten der Gemeinde -schleichender Verlust durch Abnutzung der
Infrastruktur
Der Wert einer
Gemeinde hängt im wesentlichen am Zustand der baulichen Anlagen.
Angenommen wird bei baulichen Anlagen buchhalterisch eine Wertverminderung = Verbrauch
von 2% der baulichen Anlagen.
Die Bilanzsumme einer Gemeinde gibt den finanziellen Wert der
Gemeinde an.
Mit der Bilanzsumme, dem Eigenkapital, wird also die Gesamtheit aller
Werte dargestellt. Es ist aber nicht ersichtlich, wie sich diese
Werte zusammensetzen.
Wurden in einem Jahr
neue Anlagen angeschafft (z.B. Strassen, Wege oder auch Inventar)
müßte sich die Bilanzsumme um den Anschaffungswert erhöhen, zumindest dann, wenn die
Anschaffungen aus BürgerInnens Tasche finanziert wurden.
Tut uns die Bilanzsumme diesen Gefallen
nicht, hat neben des Zuwachses des Bilanzwertes durch die
Neuanschaffungen ein Werteverbrauch stattgefunden, der nicht
ausgeglichen wurde (z.B. durch Rücklagenbildung). Uns so kann
jeder Bürger tendenziell erkennen, ob sich eine Gemeinde
"finanziell gesund" entwickelt, oder lieber mit
Neubauten liebäugelt...
Hätten wir die z.B.
145 TSD EUR für 2013 oder die 145 TSD EUR für 2014 zur Verfügung,
wäre der Erhalt der Infrastruktur gesichert.
Wer einen Einstieg in den gemeindlichen Haushalt wünscht,
kann sich unter folgendem Link informieren:
| Zustand
der Infrastruktur -Problemchen statt Probleme. |
Um zu erfassen, in
welchem Zustand sich Strassen, Wege, gemeindliche Häuser etc. pp.
tatsächlich befinden, benötigt man ein Kataster. Praktischweise
melden die BürgerInnnen der Gemeindeverwaltung wenn Defekte an
der Infrastruktur auffallen. Zudem begeht die Gemeindeverwaltung
die Gemeinde -vorzugsweise vor & nach dem Winter- die Gemeinde
und listet Schäden auf. So wird schon früh erkannt, wo
Instandsetzungsarbeiten oder Reparaturen durchgeführt werden müssen.
Ein Kataster hat aber
einen gravierenden Nachteil.
Es listet kleine Probleme auf, bevor "kleine" Probleme
zu "großen" Problemen werden.
| Ein
Kataster wurde bisher nicht eingerichtet. |
Für den "Service" der Behebung kleinerer Probleme
muß die Gemeinde Geld in die Hand nehmen.
Geld, nicht für den Kataster darselbst, sondern für Unterhaltungsarbeiten in
werterhaltendem Umfang.
Merke:
1. Große Probleme treten meist dann auf, wenn kleine Problemchen
nicht gelöst wurden.
2. Kommt es nach P.1 zu größeren Problemen, wurde meist
gemeindlich verantwortungslos gehandelt.
| Bauliche
Anlagen sind im Neuzustand zu erhalten. |
Nach der Rechtslage
sind nun endlich von der Gemeinde bauliche Anlagen im Neuzustand
zu unterhalten.
Diese Verpflichtung
der Gemeinden bedeutet in der Praxis, daß erstmals erstellte
Anlagen nie wieder als "nochmaliger" Erschließungsbeitrag
oder Ausbaubeitrag finanziert werden dürfen.
In der Vergangenheit
(s.Haushaltsjahr 2009) wurde seitens der Gemeinde einfach erklärt,
eine Anlage sei verbraucht, der Bürger darf erneut per
Ausbaubeitragsbescheid zahlen.
Nach geltender Gesetzeslage ist
dies unrecht -und dieser Sachverhalt ist den Gemeinden sehr wohl
bekannt.
Hintergrund ist die
"Harmonisierung" von Beitragsrecht und Wirtschaftrecht.
Nach dem Wirtschaftsrecht sind unterhaltende Maßnahmen
grundsätzlich aus den laufenden Einnahmen zu bezahlen
(Kreditverbot!"), während investive Maßnahmen (Neubau) auch
kreditfinanziert werden können. Nach dem Ausbaubeitragsrecht
sind aber nur investive Maßnahmen ggf. ausbaubeitragspflichtig.
Ein Rechnungsprüfer
muß bei der Prüfung der Finanzierung von baulichen Maßnahmen
zwischen "Unterhaltung" und "Investitionen"
unterscheiden. Das hört sich kompliziert an, ist aber
meistens recht simpel.
Es gilt:
a) investiv = ggf. kreditfinanziert und ggf.
ausbaubeitragspflichtig
b) unterhaltend = ausschließlich aus den laufenden Einnahmen zu
bezahlen (Tagesgeschäft), keine Kredite erlaubt.
Führt eine
Entscheidung der Rechnungsprüfer dazu, eine bauliche Maßnahme
nicht als investive, sondern als unterhaltende Maßnahme
einzustufen, hat dies nicht nur die Auflösung ggf. aufgenommener
Kredite zur Folge, sondern es hat eben auch zu einer Aufhebung von
erstellten Ausbaubeitragsbescheiden zu führen.
Die Rechnungsprüfer
erfüllen mit einer Prüfung somit indirekt die Feststellung
ausbaubeitragsfrei - oder ggf. ausbaubeitragspflichtig.
Und als
Unterhaltungsmaßnahme ist der Aufwand zu werten, den die
betreffende Anlage benötigt, um im "Neuzustand"
erhalten zu bleiben. Damit darf eine Anlage nie als
"abgenutzt" abgeschrieben werden -denn einer "Abgängigkeitsfeststellung"
liegt regelmäßig eine Pflichtverletzung in Form unterlassenener
Unterhaltungsmaßnahmen zugrunde.
Unser Gehweg und die
Beleuchtungsanlage waren m.E. unterhaltende Maßnahmen. Das
Rechnungsprüfungsgremium entschied jedoch, diese Sachverhalte
nicht zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuß entscheidet
mehrheitlich, auf eine einzelne Stimme kommt es also nicht an. Das
Problem wurde also simpel gelöst.
Aus diesem Grund habe
ich als Gemeinderat die Entlastung der Ortsbürgermeisterin und
des VG-Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2009 verweigert.
Eine amtliche Niederschrift hierzu wurde nicht veröffentlicht
-die Nichtveröffentlichung einer Erklärung eines Ratsmitgliedes
zu einem Beschlußantrag stellt ebenfalls eine
Amtspflichtverletzung dar -doch wen kümmerts?
Zurück zum
Haushaltplan und der Haushaltssatzung:
Nach den Unterlagen schließt der Ergebnishaushalt (Plus ca. 3.700 EUR)
mit Überschuß ab.
Allerdings müßte der
Überschuß wesentlich höher ausfallen.
Ein positiver
Ergebnishaushalt zeigt wie dargestellt nicht auf, ob die gemeindlichen Anlagen,
die wir BürgerInnnen z.B. per Erschließungsbeitrag, Steuern und
Abgaben schon bezahlt
haben, auch "ordnungsgemäß-werterhaltend" unterhalten werden.
Vergleichen wir einmal
auszugsweise den Verlust durch Abnutzung bei Strassen, Wege, Plätzen
mit dem tatsächlich geleisteten Aufwand bei Unterhaltung und
Bewirtschaftung:
Kosten der
Infrastruktur Teil -I-
|
Frage:
Erhalten wir unsere Infrastruktur? |
| Anlage |
Jahr |
Wertverzehr |
Aufwand
zur Unterhaltung |
Differenz/Saldo |
| Strassen,
Wege, |
2013 |
17.836,00
EUR |
4.000,00
EUR |
-13.836,00
EUR |
| Plätze |
2014 |
17.836,00
EUR |
4.000,00
EUR |
-13.836,00
EUR |
|
Antwort:
Nein, in der Gemeinde verringert sich das
Infrastrukturvermögen für Strassen, Wege, Plätze
um knapp 14 TSD EUR/Jahr. Rücklagen wurden nicht
gebildet.
|
|
Die Straßenbeleuchtungsanlage - Kosten
der Beleuchtungsanlage
Betrachten wir die Sache genauer:
Vergleichen wir nun einmal
auszugsweise den Verlust durch Abnutzung bei der Straßenbeleuchtung mit dem tatsächlichen Aufwand der geleisteten
Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstaunlicherweise übersteigen hier die
von der Gemeinde erstatteten
"Wartungskosten" den Werteverzehr.
Hier erfolgt also eine vermeintlich werterhaltende Unterhaltung.
Schön wäre es, wenn diese Anlage der Gemeinde auch gehören würde.
Interessant: Die Beleuchtungsanlage gehört dem RWE -nicht der
Gemeinde
Denn die Beleuchtungsanlage hat die Gemeinde verschenkt. Während
kleine Geschenke die Freundschaft erhalten, so der Volksmund,
scheinen größere Geschenke mit Verpflichtungen einherzugehen.
Der Verpflichtung, die verschenkte Anlage auch gleich noch bis zum
Sanktnimmerleinstag für das RWE zu unterhalten und deren Strom
bezahlend zu beziehen. Für größere Geschenke gibt es
selbstredend eine kleine Gabe -oder frei nach dem Volksmund, eine
Hand wäscht die Andere. Die "kleine" Gabe nennt sich
"Konzessionsabgabe" -mehr dazu später.
Zu erwähnen wäre
noch, das vor dem Verschenken natürlich das Bezahlen kam -bezahlt wurde die
Anlage per Ausbaubeitragsbescheid, na von wem? Richtig, von den BürgerInnen.
Beleuchtungsanlage
| Anlage |
Jahr |
Wertverzehr |
Aufwand
zur Unterhaltung |
Differenz/Saldo |
| Straßenbeleuchtung |
2013 |
2.056,00
EUR |
2.150,00
EUR |
+
96.00 EUR |
|
2014 |
2.056,00
EUR |
2.233,00
EUR |
+
177.00 EUR |
|
Daß wir die
Unterhaltung der Anlage so gewissenhaft übernehmen, wird´s freuen, das RWE.
| Anlage |
Jahr |
Stromkosten |
Erhöhung |
Differenz/Saldo |
| Straßenbeleuchtung |
2013 |
4.000,00
EUR |
|
|
|
2014 |
5.200,00 EUR |
+30% |
+
1.200,00 EUR |
|
RWE folgt damit seinem Werbeslogan voRWEgehen zumindest konsequent
-bei der Preiserhöhung.
RWE:
teure Beleuchtung
-Stromkosten steigen in 2014 um 30%- |
Zur "kleinen" Gabe:
gemeindlich finanziert wird diese Anlage letztendlich durch die
Konzessionsabgaben -eine Einnahmequelle der Gemeinde.
Die Konzessionsabgabe ist vom RWE an die Gemeinde zu erstatten.
Dafür erhält das RWE von der Gemeinde das Recht, Strom in und
durch unsere Gemeinde zu leiten, zu den Endverbrauchern und ...zu
der RWE-eigenen Beleuchtungsanlage.
Für den Bürger
ist die Konzessionsabgabe wenig vorteilhaft;
denn die Konzessionsabgabe holt sich das RWE direkt von den BürgerInnen
per Stromrechnung zurück -über die Stromrechnung.
So schließt sich dann der Kreis der Finanzierung von
Privatunternehmen durch die BürgerInnen.
Konzessionsabgabe =
2013/8.700 EUR - 2014/ 8.400 EUR
Macht pro Haushalt
ca. 80 EUR/jhrl. -ohne Konzessionsabgabe wäre Ihre Stromrechnung
um mind. 80 EUR niedriger.
Bei diesem Hintergrund
relativieren sich auch RWE Spendenaktionen für Gemeinden.
Kosten der
Infrastruktur Teil -II-
Ein
Gemeindehaus ist der Treffpunkt für die BürgerInnen -oder
sollte es sein. Neben dem "rein" finanziellen
Aspekt, gilt es die soziale Aufgabe als Begegnungsstätte
nicht außer Acht zu lassen. Daher sollte das Gemeindehaus
m.E. für nichtkommerzielle Veranstaltungen
"allen" BürgerInnen kostenfrei (außer direkten
Betriebskosten -Strom/Wasser/Heizung/Abfall) zur Verfügung
stehen.
Unterhaltung: Betrachten wir
nun unser Bürgerhaus bzgl. der Werterhaltung.
| Anlage |
Jahr |
Wertverzehr
(Haus und
Inventar) |
Aufwand
zur Unterhaltung |
Differenz/Saldo |
| Bürgerhaus |
2013 |
9.905,00
EUR |
2.000,00
EUR |
-7.905,00
EUR |
|
2014 |
9.905,00
EUR |
500,00
EUR |
-9.405,00
EUR |
| In
2 Jahren verliert das Haus knapp 20.000,00 EUR an
Wert, wir erhalten die Substanz mit nur 2.500,00
EUR. Rücklagen werden nicht gebildet. Das
bedeutet, pro Jahr verlieren wir über 8.000 EUR. |
|
Betrachten
wir nun die "soziale" Nutzung durch private
Veranstaltungen. Dazu sehen wir uns die Einnahmen an. Für
die Jahre 2013 und 2014 erwarten wir jeweils rund 2.000,00
EUR Einnahmen. Etwa 500.- bis 1000.- EUR bringen uns
"gewerbliche" Einnahmen.
Bei durchschnittlich 150.00 EUR Kosten/Tag pro
"private" Vermietung, dürfte das Haus also rund
10 Tage im Jahr vermietet sein.
Akzeptanz bei den BürgerInnen sieht anders aus.
Fazit:
Das Bürgerhaus dient kostenfrei gemeindlichen
Veranstaltungen.
Jagd-/Fischergenossenschaft, Gemeinde und VG-Manderscheid,
Forstzweckverband, Pfarrgemeinde, sowie Gruppen und Vereine
nutzen das Haus ebenfalls "kostenfrei".
Zahlen dürfen:
-die Theatergruppe bei Aufführungen,
-ortsansässige politische Wählergruppen
-Veranstaltungen der BürgerInnen (z.B.
Familienfeiern).
Diese "Gruppen" dürfen zahlen. Interessanterweise
zahlen BürgerInnen und Wählergruppe (gemeinnützig, ein
e.V.) die höchste Miete -nochmals 10.00 EUR mehr als die
Theatergruppe, aber damit die Sache richtig Spaß macht, knöpft
man der Wählergruppe auch noch erhöhte Betriebskosten
ab.
Das läßt nicht nur vermuten, daß Veranstaltungen der
Information und politischen Willensbildung gleichgesetzt
werden mit Familienfeiern, sondern das der Qualität von
Familienfeiern und Informationsveranstaltungen (hier der VBB
e.V. -Vereinigung Bürger für Bürger) zumindest
theatralisches Niveau zugeschrieben wird.
Demokratie als Burleske. Tenor: brauchen wir nicht.
Sinnvollerweise
sollten wir nun die finanzielle Gesamtsituation "Bürgerhaus"
betrachten. Wir stellen dazu Einnahmen und Ausgaben
gegenüber.
Bürgerhaus
Einnahmen (Miete,
Zuwendung) /Ausgaben (incl. Heizung, Strom,
Abfall, Versicherung...Abschreibung)
| Anlage |
Jahr |
Kosten
(Haus und Inventar) |
Einnahmen
Vermietung |
Einnahmen
Zuwendung (Landesmittel) |
Differenz/Saldo |
| Bürgerhaus |
2013 |
19.184,00
EUR |
2.000,00
EUR |
2.557,00 EUR |
-14.627,00
EUR |
|
2014 |
16.909,00
EUR |
2.000,00
EUR |
2.557,00 EUR |
-12.352,00
EUR |
Das "Bürgerhaus" kostet uns also
pro Jahr mehr als 12.000,00 EUR -oder
jeden Haushalt pro Jahr ca. 1.200,00 EUR |
|
FAZIT:
1. Offensichtlich ist das Bürgerhaus
den BürgerInnen "zu teuer".
Räume in "Gaststätten" bekommt man für eine Familienfeier
kostenfrei.
Für "mehr Leben" sollte die Preisgestaltung
privater Nutzung überdacht werden -für mehr Demokratie
scheint der Gemeindeverwaltung allerdings kein Preis zu
hoch.
2. Erst bezahlen die BürgerInnen das Gemeindehaus mit Ihre
Steuern und Abgaben, anschließend dürfen Sie für die
Nutzung nochmals blechen.
Wirtschaftswege
| Anlage |
Jahr |
Kosten
Abnutzung/
Abschreibung |
Unterhaltung/
Bewirtschaftung |
Personal-
kosten
|
Wertverlust/Jahr |
Wirtschafts-
wege |
2013 |
13.258,00
EUR |
6.000,00
EUR |
1.300,00
EUR |
ca.
7.000,00
EUR |
| 2014 |
13.258,00
EUR |
6.000,00
EUR |
1.300,00
EUR |
ca.
7.000,00
EUR |

Anhand des Beispieles
"Wirtschaftswege" ist ersichtlich,
daß eine mangelnde Unterhaltung eines Tages
zum "Totalverlust" der
Infrastruktur führt und so auf einen Schlag
exorbitante Kosten anfallen.
 |
|
Tatsächlich
waren in 2012/13 mehrere Wege erneuerungspflichtig, d.h.
eine Reparatur war wirtschaftlich nicht möglich.
Kosten der Erneuerung: für 2013/14 jeweils 103.000,00 EUR.
Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt bei dieser
Investitionsmaßnahme pro Jahr ca. 50.000,00 EUR und wird
finanziert aus der Einnahmen der Jagdpacht. Damit werden
diese Gelder zweckbestimmt verwendet.
HINWEIS: Bei vielen Gemeinden fließen die
Jagdpachteinnahmen in den "normalen" Haushalt,
dienen also der gemeindlichen Finanzierung. Dies ist oft der
Hintergrund verschlissener, unbrauchbarer Wirtschaftswege.
Die Mittel wurden zweckentfremdet verbraucht.
"Verbraucht" für andere Kosten in der Gemeinde,
weil die finanzielle, verfassungrechtlich garantierte
finanzielle Mindestausstattung seitens des Landes verweigert
wird.
Internetseite
Niederscheidweiler
hat einen neuen Internetauftritt. Der alte Auftritt erschien
einigen Ratsmitgliedern als veraltet. Zwar war der vorherige
Auftritt einfacher Bauart, da aber eine Website nicht durch
Design, sondern erst durch Inhalt zu glänzen pflegt, ist
die Kritik nur dann berechtigt wenn erstens neue Inhalte
folgen und zweitens das alte Design den Einbau dieser
Inhalte nicht ermöglicht.
Ich danke
jedenfalls dem "Ersteller und Betreuer" der alten
Seite von ganzem Herzen, zumal diese Tätigkeit der Gemeinde
nicht in Rechnung gestellt wurde.
Apropos
kostenfrei:
Da Webportale keine Hexenkunst benötigen, sondern meist mit
viel Schall und Rauch sowie handwerklichem Geklappere
ahnungslosen "Kunden" angedient werden, habe ich
der Gemeinde mehrfach angeboten ein kostenfreies Portal zu
erstellen und für kleines Geld jährlich zu hosten.
Mit bis zu 60.00
EUR dürfte z.B. die jährlichen Betriebskosten abgegolten
sein. Will man ein paar nette funktionale Sachen einbauen,
z.B. Kartenbestellungen, Brennholzverkauf oder auch private
Kleinverkäufe ermöglichen oder Angebote von
Dienstleistungen buchungsfähig darstellen, dann braucht es
noch ein wenig Geld fürs Script. So mit 200.00 bis 250.00
EUR ist man letztendlich aber "uptodate".
Selbstverständlich
würden alle Rechte des "Eigenbaus" von mir auf
die Gemeinde übertragen, ebenso erfolgt der Zugriff und die
Verwaltung unter hoheitlicher Verantwortung.
Kommen wir zur
Sache. Bevor irgendwas online geht, sollte man sich ein paar
Gedanken machen. Z.B. welche Anforderungen und Wünsche
haben die BürgerInnen und die ortsansässigen Betriebe,
welche Anforderungen die Gemeindeverwaltung, welche Wünsche
haben die Vereine und Gruppierungen.
Da macht eine
Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Sinn. Dies habe ich
mehrfach auf Ratssitzungen eingefordert mit dem Ergebnis der
Ablehnung -BürgerInnens Wünsche scheinen da eher
uninteressant.
Ohne eine
Vorstellung wurde dann eine Firma beauftragt, die Firma Cox.
Diese Firma sollte eine Präsentation erarbeiten und auf
einer Ratssitzung vorstellen. Diese Firma hielt allerdings
nichts von "Vorarbeiten" und Vorab-Präsentationen.
Ohne Vorauszahlung, ohne Beschluß zum kostenpflichtigen
Auftrag (EUR 2.500,00), weigerte sich Hr. G., der Geschäftsführer,
irgendwas zu präsentieren. Auch über die Folgekosten wurde
kein Wort erklärt.
Wesentlich sind
neben der Erstellung des "Webportals" die
Nutzungs- und Eigentumsrechte. Und diese Rechte hat der
Gemeinderat in seiner für mich unergründlichen Weisheit
erst gar nicht abgeklärt. Statt dessen erfolgte der
Mehrheitsbeschluss (meine Gegenstimme) für die pauschale,
freibriefliche Webseitenerstellung mit kleinem Vorschuß von
1250,00 EUR an Hr. G.
Und so präsentierte
sich die Webseite dann kurze Zeit später in durchaus gefälligem
Design, angereichert mit Animationen, Schreibfehlern und
fehlerhaften Angaben. Inhaltsmäßig wurde die Seite zwar
(noch) unter dem Gehalt der alten Webseite angelegt, aber für
den Inhalt zeichnet der Webentwickler eher nicht
verantwortlich. Aber wenigstens waren die Rechte geklärt; Alle Rechte beim
Autor (einem mir unbekannten Hr. J.S.) oder bei der Firma
Cox.
Es stellt sich
nun die Frage, für wen die Homepage eigentlich kreiert
wurde? Zumindest sollte der geneigte Besucher über einen
DSL-Anschluß verfügen. Mit Analogtechnik oder gedrosseltem
Datendurchsatz dürfte vor dem Aufbau der Seite der
Kaffeeverbrauch drastisch ansteigen.
Denn sich ständig
wiederholende Filmsequenzen nerven nicht nur, es braucht
einfach zu viel Zeit. Zeit zur Selbstfindung?
Meist sind es daher eher
narzistisch angehauchte Webdesigner, die dem faktischen
Kunden derartige Intros andienen.
Nach dem Motto, bringt nichts, kostet aber, und läuft ohne
Unterlass...wünscht man sich einen Schalter zum Abschalten.
Professionelle Webdesigner versehen Filmchen daher nicht mit
einem Ausschalter, sondern mit einem Einschalter!
Zu beobachten
sind also "Animationen"
in Form kleiner, sich ständig wiederholender Filmsequenzen.
Dem Besucher jedenfalls mutet eine derartige Webseite
einiges an Langmut ab. Eine Eigenschaft, die Internetnutzern
eher fremd ist.
Bleibt noch der
Vertragstext, welcher dem Gemeinderat bisher nicht vorgelegt
wurde. Rechte und Pflichten, Kosten und Nutzung, der
Vertragstext dürfte aufgrund der vorliegenden Webseite interessant
sein. Ebenso mit Spannung dürfte die erste Rechnung der Fa.Cox,
respektive des Autors für die Nutzung und Veröffentlichung, sei
es im Internet oder zusätzlich in den Printmedien, erwartet
werden dürfen.
Rechtlich
gesehen sind die Nutzungs- und Eigentumsrechte für den
Anbieter/Autor gegenüber der Gemeinde ggf. frei
kalkulierbar.
Bei solchen Basta-Beschlüssen darf nach "cui bono"
durchaus gefragt werden.
Auszug:
Webseiten metatext, Webseiten: "author"
content="Jan
Schiffer"
Auszug: Impressum
1. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen
Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen
oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.
Allein aufgrund der
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet. |
Thema
Einnahmen
-Steuern, Abgaben,
Beiträge-
Bisher wurde
hauptsächlich die Kostensituation betrachtet. Kommen wir
nun zu den Einnahmen.
Hier habe ich die Einnahmen zum besseren Verständnis
aufgeteilt:
Teil 1 -Haupteinnahmen (Landeszuweisungen) -Ausführung
dazu finden Sie am Anfang der Seite
Teil 2 -gemeindliche Einnahmen aus Steuern, Beiträgen,
Abgaben und insbesondere der Forstwirtschaft sowie der
Energieerzeugung.
Jede Gemeinde
hat ein Recht auf "eigene" Einnahmen. Dieses Recht
dient der Sicherstellung der finanziellen Unabhängigkeit außerhalb
der vom Land/Bund zugeführten Mittel.
Die
Bundes-/Landesmittel dienen "rechtlich" der
"Sicherstellung" der gemeindlichen Existenz,
garniert mit ein paar finanziellen Brotkrumen für eine
vermeintliche Weiterentwicklung einer Gemeinde.
"Weniger" läßt das Gesetz einfach nicht
zu.
Daher gibt man
den Gemeinden notgedrungen diese Gelder, allerdings nur um
unverzüglich die Mittel weitestgehend in Form von Umlagen
wieder abzugreifen.
Als wenn diese
Burleske nicht ausreichen würde, erhöhen Land und Bund
seit Jahren die finanziellen Verpflichtungen der
Gemeinden.
So zahlen wir
z.B. für die Kita Niederöfflingen in 2013 über 5.000 EUR
und in 2014 über 7.000 EUR.
Tatsächlich wären
die Kita-Kosten vom Land zu bezahlen, respektive vom
Bund.
Denn es gilt das Konnexitätsprinzip, bei gesetzlichen
Verpflichtungen zahlt die Institution, welche den
Gesetzgeber includiert.
Wie schon ausgeführt
wurde, ist verfassungsmäßig geklärt, daß weder das Land
noch der Bund der grundgesetzlich garantierten
Finanzausstattung auch nur im Ansatz nachkommt. Unserer
Gemeinde dürften für eine verfassungsgemäße Finanzierung
sicherlich 100.000,00 EUR/pro Jahr fehlen.
Umso lieber
benutzt jetzt die Landesregierung mit den Aufsichtsbehörden
die Forderung nach Ausschöpfen der gemeindlichen
Steuer-/Abgaben- und Beitragserhebung.
Sprich, die
Aufsichtsbehörde (ADD) und die Kommunalaufsicht des Kreises
verlangt spätestens zur "Schuldensanierung" eine
drastische Erhöhung der kommunalen Steuern, Beiträgen,
Abgaben.
Das Zauberwort
heißt Entschuldungsfonds.
Gemeinden,
welche an dem Entschuldungsfonds teilnehmen, werden
gezwungen die eigenen Bürger bis aufs Äußerste finanziell
zu belasten.
Die
gemeindlichen Einnahmen müssen derart erhöht werden, daß
innerhalb von 10 Jahren eine Gemeinde schuldenfrei
ist.
Beispiel:
Verschuldung 1 Mio EUR, bei 100 Haushalten in einer OG macht
das 1.000 EUR Mehreinnahmen pro Jahr/Haushalt.
Unbedarft könnte BürgerIn nun annehmen, daß jeder
Haushalt 1000 EUR mehr Kosten pro Jahr zu tragen hätte.
Das wäre
bitter, doch die Wahrheit ist viel grausamer.
Denn von den meisten gemeindlichen Einnahmen werden, wie
ausgeführt, erst einmal die Umlagen bedient.
Muß die Gemeinde z.B. 1.000 EUR/Jahr pro bürgerlichem
Haushalt zusätzlich und real zur Verfügung haben, dann
werden die BürgerInnen bei umlagepflichtigen Einnahmen mehr
als das 6-fache berappen dürfen. Denn bei umlagepflichtigen
Einnahmen, bedient sich mit über 85% Abzug die
VG-Manderscheid und der Landkreis Bernkastel-Wittlich.
Zu den
umlagepflichtigen Einnahmen dürften die Grundsteuer A/B,
jede Aufwandssteuer (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer,
Gartenzaunsteuer..) und per Gewerbesteuerumlage auch die
Gewerbesteuer zählen.
Es macht daher aus gemeindlicher Sicht keinen Sinn,
umlagepflichtige Steuersätze zu erheben. Diese Steuern verärgern
die BürgerInnen, die Gemeinde bekommt von diesen
Steuereinnahmen nur Peanuts, alleinig Kreis und VG sind
hocherfreut.
Eine Gemeinde existiert demnach in erster Linie zur Freude
der Verbandsgemeinden und der Landkreise -nur nicht zur
Freude der BürgerInnen.
Wer jetzt aber
glaubt, daß der Gemeinderat in hoheitlicher Aufgabenfüllung
die Hebesätze (Multiplikatoren) einfach auf null setzten könnte,
der irrt gewaltig. Um nämlich nicht leer auszugehen, hat
man das hoheitliche Recht der Gemeinden zur Festsetzung der
Hebesätze ein wenig "modifiziert".
Modifiziert mit der Verpflichtung, z.B. bei der Grundsteuer
B, Umlagen an den Kreis und die VG "zwangsweise"
abzuführen -derzeit bezogen auf einen
"virtuellen" Mindestsatz von ca. 360 v.H.
Klartext:
Wenn unsere Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer B
auf null setzen würde (der Autor hätte dafür ein
offenes Ohr), zahlen wir dennoch Umlagen an die VG und den
Kreis, derzeit in Höhe von ca. 13.000 EUR. Nochmals: bei
null EUR Grundsteuererinnahmen.
Diese Persiflage
von Rechten finden Sie, lieber Leser, in diesem Land
strukturell. Freiheiten werden garantiert -und sehr wirksam
durch die Hintertür eingeschränkt. Sollten Sie z.B. bei
einem Gesetz lesen "jeder Mensch ist frei,"
achten Sie auf den Zusatz " Näheres regelt ein
Gesetz".
| Um
aus dem Dilemma der gemeindewertenteigneten Umlagenpflicht
zu kommen, hilft nur das Durchsetzen der Forderung der
finanziellen Mindestausstattung und hier sowohl fordernd für
Ortsgemeinden, als auch für Verbandsgemeinden und für
Landkreise. |
Haushaltsberatung
-Steuererhöhung-
1. Beraten
wird über die Grundsteuer B mit derzeitigem Hebesatz von
320 v.H.
Die Erhöhung wird vorgeschlagen auf 340 v.H.
2. Beraten wird über die Gewerbesteuer mit derzeitigem
Hebesatz von 330 v.H.
Die Erhöhung wird vorgeschlagen auf 340 v.H.
Für die Gemeinde bedeutet ein Verzicht auf eine
Anhebung der Hebesätze auch kein nennenswertes Minus. Die
Gemeinde zahlt nicht "drauf", die Gemeinde führt
einfach einen höheren Anteil ab.
Klartext:
Die Einnahmen der Grundsteuer B gehen "einfach"
komplett an die VG und den Kreis -mit einem herzlichen Dank
an die VG und den Landkreis.
Aus der o.a.
Ausführung ist ersichtlich, daß ich als Ratsmitglied
keiner Erhöhung
-der Grundsteuern
-der Gewerbesteuer (die gehört m.E. abgeschafft)
-und irgendwelcher Aufwandsteuern (etc. Hundesteuer)
zustimmen werde.
| Keine
Steuererhöhung mit Ratsmitglied Axel Burdt |
Weitere
Einnahmen -umlagenfrei-
Umlagenfrei
sind die Einnahmen z.B. aus der Forstwirtschaft. Für unsere
BürgerInnen dürfte insbesondere der Brennholzpreis für
angedientes Langholz am Wegesrand, Buche oder Eiche
interessant sein.
Der
Forstzweckverband schreibt schwarze Zahlen. Die Einnahmen
sind äußerst erfreulich, zumindest für die Gemeinden und
den Forstzweckbverband darselbst. Aufgrund der explodierend
gestiegenen Holzpreise schwimmen die Forstwirtschaften im
Geld. Unser Fortzweckverband hat in wenigen Jahren eine Rücklage
an freien Finanzmitteln in Höhe von mehr als 200.000,00 EUR
erwirtschaftet. Zuzurechnen sind noch die Ausschüttungen an
die Gemeinden. Für 2014 (2013>6.000,00 EUR) erwarten wir
eine Steigerung der Ausschüttung von über 50 %, respektive
mehr als 10.000 EUR.
Diese
Einnahmesituation muß in Bezug zum Brennholzpreis gesehen
werden. Laut der Gemeindeordnung dient ein Gemeindewald auch
der Versorgung der BürgerInnen -mit z.B. Brennholz. Ich
habe weder als Ratsmitglied, noch als Bürger irgendein
Verständnis dafür, den BürgerInnen Brennholz zum Verkauf
oberhalb des Entstehungspreises anzudienen.
Für mich ist
der Selbstkostenpreis der Forstwirtschaft bei der
Bereitstellung des Brennholzes maßgebend.
Die Zahlen zur Kalkulation des Einstandspreises
"Brennholz" unserer Forstwirtschaft sind mir nicht
bekannt und auch nicht Gegenstand der mir vorliegenden
Beratungsunterlagen.
Der Betrieb "Landesforsten" und andere Quellen
geben durchschnittliche Kalkulationen zum Selbstkostenpreis
bekannt:
Lt. mir vorliegender Information kalkuliert sich demnach ein
FM Langholz durchschnittlich mit 18.00 EUR als
Selbstkostenpreis.
Brennholz
für Eigenbedarf
Der Preis für die BürgerInnen darf die Selbstkosten des
Erzeugers (Forstzweckverband) nicht übersteigen. |
Rechnen wir
aus BürgerInnens Sicht -was kostet Brennholz, wie teuer ist
die Alternative?
1. Kosten für die Verbringung des Langholzes zur
Verarbeitungsstätte
(Traktor, LKW, PKW-Hänger, Motorsäge)
Kosten: ca. 10 EUR/RM
2. Kosten zur Aufarbeitung des Holzes (sägen/spalten
-Strom/Betriebsstoffe, Gerätekosten)
Kosten: ca. 15 EUR per RM
3. Arbeitszeit pro RM ca. 2h
Kosten: ca. 20,00 EUR (eher eine Aufwandsentschädigung)
Fazit:
Preis, ohne den Rohstoff Holz, ohne Arbeitskraft: 25.00
EUR/RM
Preis, ohne den Rohstoff Holz, mit Arbeitskraft: 45.00
EUR/RM
Frage:
Was darf der Rohstoff kosten, um den Rohstoff wirtschaftlich
einzuordnen?
Als Vergleich nehmen wir einen anderen Festbrennstoff, z.B.
Braunkohlebriketts.
Braunkohlebriketts:
Kosten für 1 Tonne Braunkohlebriketts: ca. 200.00 EUR
Umrechnung Buche / Braunkohle: ca. 3 zu 1
D.h. ca. 3 RM Buche werden als Ersatz für eine Tonne
Braunkohlebriketts benötigt.
Wirtschaftlichkeitsberechnung:
200 EUR : 3 = 66.66 EUR = max. wirtschaftlicher Preis für
einen RM Buchenbrennholz
66.66 EUR, abzgl. Kosten 45.00 EUR = 21.66 EUR / RM
Buchenholz
21.66 EUR x 1.42 (Umrechnung RM zu FM) = 30.75 EUR / FM
Buchenholz, lang
Fazit:
1. Bei wirtschaftlicher Berechnung ist ein Holzpreis
oberhalb von 30.00 EUR/FM schlichtweg unrentabel.
2. Der forstwirtschaftliche Selbstkostenpreis dürfte unter
ca. 20.00 EUR/FM für Langholz, am Wegesrand gelagert,
liegen.
3. Der Forst würde bei 30.00 EUR/FM einen Gewinn von 50%
einfahren.
Unsere Gemeinde berät jedoch über einen Holzpreis in Höhe
von 44.00 EUR/FM.
Stimmen die Informationen zum Selbstkostenpreis,
kalkuliert der Forst/die Gemeinde mit 120% Aufschlag.
Das ist nicht nur unsozial, es beleidigt diejenigen, die aus
wirtschaftlichen Gründen oder aus Überzeugung der
Verwendung heimischer Energien mit Brennholz heizen.
|
Forderung: |
| Senkung
des Holzpreises (Buche, Langholz, am Wegesrand) für
den Eigenbedarf auf den Selbstkostenpreis des
Forstzweckverbandes, jedoch max. 30.00 EUR/FM |
|
Rückfragen bitte
an Ratsmitglied Axel Burdt -a.burdt(aet)vbbev.de
|